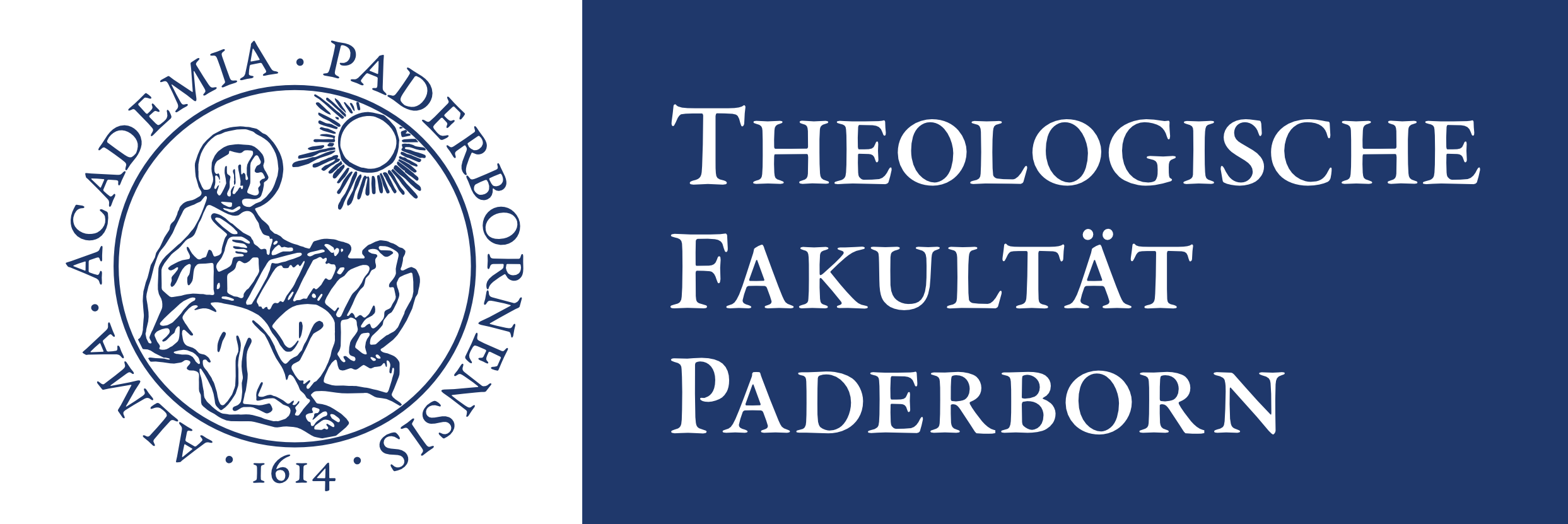Professor Wilhelms wurde 2004 auf den Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre der Theologischen Fakultät Paderborn berufen. 2013 rief er die Kooperation Wirtschaftsethik mit Professor Fahr, Vizepräsident der Universität Paderborn und Lehrstuhlinhaber für Betriebswirtschaftslehre, insb. Corporate Governance, ins Leben. Die Lehrveranstaltungen der beiden Lehrstühle stehen Studierenden beider Institutionen offen. Die interessierte Öffentlichkeit wird im Rahmen dieser Kooperation mit dem Forum Wirtschaftsethik zu aktuellen Themen angesprochen. Professor Wilhelms ist außerdem Initiator und Vorstand des Ethikrates Digitalisierung Paderborn. An der Fakultät lehrte und forschte er bis zum Ende des Sommersemesters 2024; am 5. Dezember hielt er seine Abschiedsvorlesung. Heike Probst, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Fakultät, sprach mit Professor Wilhelms über zwanzig Jahre Forschens und Lehrens an der Fakultät und die Inhalte und Aufgaben einer zeitgemäßen Sozialethik.
Heike Probst: Lassen Sie uns Rückschau halten auf Ihr Wirken an der Fakultät – was bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Sehr prägend war mein Einstieg und die sehr, sehr zügige Übernahme von Verantwortung als Rektor 2006. Das ging sehr schnell, für meine Begriffe ein bisschen zu schnell damals, auch wenn ich als ehemaliger Akademiedirektor schon etwas Erfahrung im Umgang mit Institutionen mitbrachte. Die Fakultät und ihr Umfeld bedeuteten schon eine besondere Herausforderung. Dazu kam, dass in diese Zeit die ersten massiven Forderungen nach Kürzungen in Form von Stellenabbau fielen – ein schmerzhafter Prozess zu Beginn eines Rektorats. Und das andere, was auch mit meinem Rektorat verbunden war und auch bis heute eine große Rolle spielt, war und ist das Bemühen um Kooperation, vor allem mit der Universität Paderborn. Leider bis heute ohne den wünschenswerten Erfolg.
Eine ganz zentrale Rolle nimmt für mich das Themenfeld Wirtschaftsethik ein. Nachdem ich bereits kurz nach meiner Berufung mit einem anderen Kollegen an der Uni Paderborn regelmäßig gemeinsame Seminare durchgeführt hatte, kam es mit dem damals frisch berufenen Kollegen Réne Fahr rasch zur Aushandlung einer Kooperationsvereinbarung, die die Lehrveranstaltungen beider Lehrstühle für die Studierenden wechselseitig öffnete. Und die es bis heute gibt. Réne Fahr und ich haben uns von Anfang an auch darum bemüht, nach außen Signale zu senden, also über die Universitätsgrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das Thema Wirtschaftsethik zu erzeugen.
Heike Probst: Wie kann ich mir das vorstellen?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Wir haben zunächst Ringvorlesungen durchgeführt, die eine große Resonanz gefunden haben. Die Hörsäle waren richtig voll. Für mich war die Kooperation Wirtschaftsethik eine sehr prägende, bis heute wichtige Entscheidung, denn sie hat mich zu weiteren Kooperationen und Engagements außerhalb der Fakultät motiviert wie die Mitgliedschaft im Diözesan-Ethikrat der Caritas und die Initiierung des Ethikrates für Digitalisierung in Paderborn. In Kooperationen mit dem DGB und der evangelischen und katholischen Kirche haben wir über viele Jahre Sozialkonferenzen in der Fakultät veranstaltet. Zunächst ging es um einen Armuts- und Reichtumsbericht für die Stadt Paderborn. Das nächste große Thema, dass auch in mehreren Sozialkonferenzen behandelt wurde, war dann die Digitalisierung. Dieses Engagement mündete in die Gründung des schon erwähnten Ethikrates.
Heike Probst: Sie haben Ihre Lehrtätigkeit immer damit verknüpft, auch politisch in der Gesellschaft aktiv zu sein?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Das entspricht meinem Verständnis von christlicher Sozialethik, sich eben nicht nur auf der Begründungs- und rein theoretischen Ebene zu bewegen. Man muss auch ausloten, was in bestimmten Handlungskontexten konkret möglich ist. Wie kann man Ethik ins Spiel bringen? Das habe ich auf verschiedene Weisen ausprobiert und das Format Ethikrat spielt dabei eine besondere Rolle.
Heike Probst: Welchen Einfluss können Ethikräte denn nehmen?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Ich sehe nicht, dass die Ethikräte sozusagen direkt Einfluss nehmen könnten im Sinne einer konkreten Option oder sogar einer Handlungsanweisung an die Politikerinnen und Politiker oder Verantwortliche. Ethik ist eher als eine Art von begleitender Reflexion zu verstehen, eine Art Sand im Getriebe, eine Anregung und Aufforderung, nachzudenken. Sozialethik stellt immer die Fragen: Was machen wir da? Warum machen wir das? Was macht das mit uns? Wenn etwa die Verwaltung der Stadt Paderborn digitalisiert werden soll, dann versucht der Ethikrat mit der Personalvertretung und den Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen und auf diese Weise die Sensibilität für ganz bestimmte, wichtige Perspektiven zu erhöhen oder Probleme sichtbar zu machen. Wir stellen dann z.B. Fragen nach der Beteiligung der Betroffenen, müssen die Angebote möglicherweise niederschwelliger organisiert werden? Oder wir suchen nach versteckten, nicht unbedingt beabsichtigten Manipulationen. Solche Fragen spielen eine ganz zentrale Rolle. Es ist immer wieder das Bemühen, innezuhalten und nicht einfach die verschiedenen Projekte laufen zu lassen. Denn die Gefahr ist groß, das habe ich in den Jahren deutlich zu spüren bekommen, dass wenn etwa eine Verwaltungsabteilung im Auftrag der Politik ein bestimmtes Digitalisierungsprojekt umsetzen will, sie sehr stark darauf fixiert ist, dass alles technisch funktioniert und nicht zu teuer wird. Was diese Maßnahmen für die Betroffenen und Beteiligten bedeuten, gerät schnell aus dem Blick.
Heike Probst: Als Hemmschuh oder Sand im Getriebe macht man sich nicht nur Freunde?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Für die Verantwortlichen ist das erst einmal gar nicht angenehm. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Verantwortlichen diese intensiven Gespräche mit der Zeit als ausgesprochen hilfreich empfinden. Aber es ist mühsam und alles andere als einfach. Ich muss immer wieder an einen Werbeslogan der FDP aus dem Wahlkampf 2017 denken. „Digital first“, heißt es dort, „Bedenken second“. Der Ethikrat bzw. ich sehen das umgekehrt. Bedenken sind wichtig und unverzichtbar. Und es ist sogar so: Je besser etwas läuft, jetzt rein technisch betrachtet, umso eher muss man als Ethiker sagen, stopp, wir müssen auch zwischendurch mal den Kopf heben und schauen, was wir da eigentlich machen und warum. Wenn es die Aufgabe einer Verwaltung ist, Dienst am Bürger zu leisten, dann muss man sich immer wieder fragen, ob das Projekt eigentlich diesem Ziel dient.
Heike Probst: Würden Sie sagen, dass ein solches Innehalten mittlerweile immer mehr zu kurz kommt, weil die Zeit so schnelllebig ist?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Ich glaube, dass das grundsätzlich zu kurz kommt, in allen möglichen Bereichen, vom Gesundheitssystem über Digitalisierung bis hin zur Bildung. In all diesen Bereichen wäre es so wichtig, immer wieder innezuhalten und zu fragen, warum wir das eigentlich machen und wie uns diese Prozesse verändern. Und da spielt die Digitalisierung aus meiner Sicht auch eine besondere Rolle. Alle diese Bereiche sind in den letzten Jahren stark darauf fokussiert, durch digitale Technik vermeintlich oder tatsächlich ihren Bereich zu optimieren. Und der Fokus liegt eindeutig auf den technischen Vollzügen. Gerade im Bereich der Bildung wäre es so wichtig, auch die Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen in die Fragestellung, was mit uns geschieht, während wir diese Technik benutzen. Wir verändern unsere Umwelt und prägen unser Denken, Fühlen, Handeln. Das in den Blick zu nehmen, kommt viel zu kurz. Und diese Fragen kann man nicht nur einmal stellen, sondern sie müssen eigentlich, das meine ich mit dem parallel mitlaufenden Reflexionsprozess, institutionalisiert werden, beispielsweise durch Ethikräte. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, so eine Begleitreflexion auf Dauer zu stellen.
Heike Probst: Stellt sich da aber nicht die Frage, ob sich diese Begleitreflexion eben durch diese Kontinuität abnutzt?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Ja, die Gefahr ist riesengroß und man muss sich tatsächlich einiges einfallen lassen, dagegen zu arbeiten. Wir können nur dranbleiben. Wir können versuchen, solche Initiativen und solche Organisationsformen mit Leben zu füllen. Und letztlich sind solche Bemühungen natürlich immer darauf angewiesen, dass es so etwas wie ein indirektes Wirken „in the long run“ gibt. Als Ethiker, der sich intensiv mit der modernen Gesellschaft, ihren Mechanismen und Antriebskräften beschäftigt hat, bin ich sehr zurückhaltend mit meinen Erwartungen, wenn es darum geht, direkten Einfluss auf Dritte auszuüben. In der Kommunikation miteinander besteht die Hoffnung darin, dass Verständnis entsteht und das dann zu Veränderungen führt. Das ist ein mühsamer Prozess. Und man kann solches Engagement auch in seiner Wirkweise nur bedingt kontrollieren. Meine Hoffnung besteht darin, dass die verschiedenen Lebensbereiche, die sich in unserer Gesellschaft entwickelt haben, also Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Technik, Religion, Kunst, dass diese verschiedenen Lebensbereiche sich sozusagen wechselseitig relativieren. Und dass nicht bestimmte Bereiche die Führung übernehmen und wir dann irgendwann wach werden und erkennen müssen, dass wir, wenn wir denken, fühlen und handeln wollen, nur noch auf ökonomische Rationalitäten zurückgreifen können. Sondern dass da noch etwas anderes ist wie die Ethik. Oder so etwas wie Orte, Zeiten, Symbolformen aller Art, die andere Bewusstseinsformen vermitteln. Wenn wir nicht alle Aufmerksamkeit auf diese Bereiche und Alternativen richten, dann wird es düster aussehen. Auf der einen Seite erscheint die Gesellschaft insgesamt als starr, sprachlos, eigensinnig, wie sich die Gesellschaftsanalytiker ausdrücken. Die Menschen erleben sich als mitgerissen von anonymen Kräften. Auf der anderen Seite steigt der Frust, die Stimmung wird gereizter, angespannt, ja aggressiv.
Heike Probst: Das ist aber eine sehr düstere Perspektive.
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Aufgabe der Ethik ist es, die Dinge beim Namen zu nennen, aufzuklären, um Veränderung möglich zu machen. Deshalb sind Ethiker auf der einen Seite immer skeptisch, aber sie sind auch Optimisten, denn eine der wichtigsten Prinzipien ethischen Denkens ist, die Welt des Möglichen offen zu halten. Also nicht das, was der Fall ist, ist es und Ende, sondern das, was der Fall ist, muss immer unter Vorbehalt des Möglichen betrachtet werden. In diesem Sinne ist Ethik Utopie.
Heike Probst: Welche Aufgabe hat denn die Religion in dieser Utopie?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Religion und Kirche haben meiner Meinung nach ähnlich wie die bildende Kunst, die Musik oder die Architektur die Aufgabe, Orte zu schaffen, an denen Menschen ihrer Sehnsucht Ausdruck verleihen können. Sehnsucht ist etwas, was der Mensch nicht von Natur aus mitbringt, sondern etwas, das Gestalt gewinnen muss. Sehnsuchtsorte und ihre Ausdrucksformen müssen in unserer Gesellschaft gepflegt werden. Die Digitalisierung, Smartphones und soziale Medien spielen hier sicher eine große Rolle. Aber wir sollten ihnen diese Aufgabe nicht überlassen. Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass diese Medien dazu verleiten, sich zurückzuziehen, dass sie eine billige, selbstbezügliche Ausdrucksform anbieten, die eher verführt und nicht wirklich herausfordert.
Heike Probst: Wie müsste sich denn die Arbeitswelt in diesem Sinne entwickeln?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Die Arbeitswelt ist sicher eine der wichtigsten Lebensbereiche des Menschen. Deshalb ist es um so wichtiger, dass sich auch die Arbeitswelt entsprechend verändert, so, dass sie tatsächlich als etwas begriffen werden kann, in der der Einzelne seine konkrete Freiheit auch leben kann, dass sie Gelegenheiten bietet, Achtung und Anerkennung zu erleben, Selbstwirksamkeit zu erfahren, dass nicht nur Anpassungsdruck herrscht. Ich weiß, dass sind schöne Worte, aber sie sollen daran erinnern, dass auch die Erwerbsarbeit dem Menschen zu dienen hat.
Darf ich noch einmal kurz auf die Kirche zu sprechen kommen und die Aufgabe der christlichen Sozialethik? Die Sozialethik ist nicht nur ein Instrument, dass es den Verantwortlichen in der Kirche erlaubte, ihre Ziele rationaler oder effektiver umzusetzen. Sie kann, weil sie auf die Bedingungen von Freiheit fokussiert, zur Selbstaufklärung kirchlicher Vollzüge beitragen. Beispiel Profilierungsbemühungen kirchlich-caritativer Einrichtungen (die Einrichtungen sollen als kirchliche erkennbar werden): Was auf den ersten Blick als Konzentration aufs Eigene erscheint, lässt sich möglicherweise auch als Anpassung an die moderne funktionale, arbeitsteilig organisierte Gesellschaft begreifen. Oder die Rolle religiöser Ästhetik: Ist sie nicht gerade heute, für die moderne Gesellschaft, besonders anschlussfähig? Weil sie auf die Form, nicht den Inhalt fokussiert, weil sie Unbestimmtheit zulässt und dadurch Spielräume eröffnet, nicht zwingt, Deutungsangebote macht, die Differenz zwischen Dogma, Amt und Autonomiebewusstsein erträglicher sein lässt?
Das große Dilemma der Kirche heute scheint mir ja darin zu liegen, dass die Spannung zwischen dem Anspruch auf Autonomie und Freiheit auf der einen und Dogmatik und Hierarchie auf der anderen Seite ihre Glaubwürdigkeit unterhöhlt. Der Missbrauchsskandal hat dieses Dilemma verschärft.
Heike Probst: Was würden Sie Ihrer Disziplin denn für die Zukunft wünschen?
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Zunächst wünschte ich mir, dass sie die nötige Aufmerksamkeit auch in der Kirche und der Theologie findet. Gerade weil sie sich auf die strukturellen und institutionellen Bedingungen konzentriert, ist sie eine angemessene Perspektive im Umgang mit Autonomie und Freiheit heute. Dabei sollte sie keine falschen Hoffnungen wecken: Sozialethik hat keine Handlungsanweisungen zu geben, die dann von den Verantwortlichen nur noch umgesetzt werden müssten. Mein Verständnis von Ethik ist bescheidener: Sie kann nur begriffliche Instrumente zur Verfügung stellen, die eine etwas klarere Sicht auf die Wirklichkeit erlauben und verantwortliches Handeln ermöglichen. Dabei könnte es hilfreich sein, wenn sie den Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen richtete und stärker als bisher auf die Kulturtheorie und Kulturphilosophie zurückzugriffe, weil sie dabei helfen könnten, das Wechselgeschehen zwischen Individuum und Gesellschaft genauer zu analysieren, ohne die „Härte“ und Eigensinnigkeit der gesellschaftlichen Mechanismen zu verharmlosen und naiv zu reagieren.
Heike Probst: Was wünschen Sie Ihrer Fakultät für die Zukunft
Prof. Dr. Günter Wilhelms: Ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Die Herausforderungen sind groß, die Skepsis gegenüber der Theologie wird in unserer Gesellschaft spürbar größer. Sie sollte der Versuchung widerstehen und sich nicht zu sehr auf sich selbst konzentrieren oder auf den Kontakt zu anderen kirchlichen Einrichtungen; sie sollte nicht nachlassen in dem Bemühen, in allen gesellschaftlichen Kräften und Organisationen nach Kooperationsmöglichkeiten zu suchen. Und sie sollte sich immer daran erinnern, dass die Theologie kein Selbstzweck ist, sondern den Menschen dienen soll mit ihren Erkenntnissen.
Heike Probst: Herzlichen Dank für das Gespräch!
Weitere Informationen
Prof. Dr. Günter Wilhelms war seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Gesellschaftslehre an der Theologischen Fakultät in Paderborn. Zwischen 2005 und 2007 bekleidete er das Amt des Rektors und war von 2009 bis 2019 in der Schriftleitung der Zeitschrift „Theologie und Glaube“ tätig. Gemeinsam mit Prof. Dr. René Fahr, der den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Corporate Governance an der Universität Paderborn innehat, initiierte er 2013 die „(Lehr)Kooperation Wirtschaftsethik“ zwischen der Fakultät und der Universität Paderborn sowie das Diskussionsformat „Forum Wirtschaftsethik“, das alle zwei Jahre stattfindet.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Wirtschaftsethik sowie in der politischen Ethik, der Kultur, der Kirche und der Religion in der modernen Gesellschaft. Neben seinen Lehr- und Forschungstätigkeiten ist Professor Wilhelms Mitglied des Kuratoriums und des sozialwissenschaftlichen Arbeitskreises der Kommende Dortmund, des Nachhaltigkeitsbeirats der Bank für Kirche und Caritas, der Internationalen Vereinigung für Moraltheologen und Sozialethiker sowie des Arbeitskreises Kirchen und Gewerkschaften in Paderborn. Zudem ist er Vorsitzender des Ethikrates Digitalisierung der Stadt Paderborn. Außerdem war er langjähriges Mitglied des Diözesanen Ethikrats im Caritasverband für das Erzbistum Paderborn.
Ursprünglich stammt Professor Wilhelms aus dem ostwestfälischen Borgentreich. Er studierte Katholische Theologie, Psychologie und Soziologie an den Universitäten Paderborn, Würzburg und Eichstätt. Nach seiner Promotion im Fach Pastoraltheologie habilitierte er sich in Christlicher Sozialethik. Auf eine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Assistent und später als Oberassistent an den Universitäten Eichstätt und Bamberg folgte eine außerplanmäßige Professur für Christliche Soziallehre an der Universität Bamberg sowie die Leitung der Katholischen Akademie Stapelfeld, bis er schließlich nach Paderborn berufen wurde.