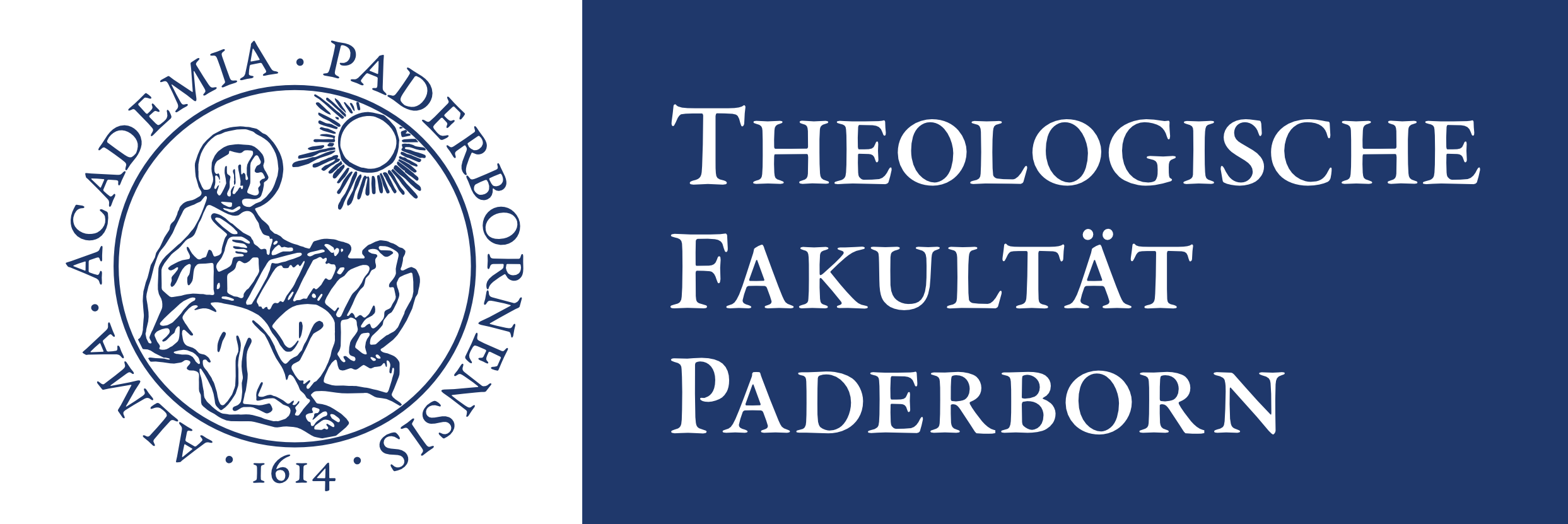Die Päpstliche Bulle „De salute animarum“ vom 16. Juli 1821 hat vor genau zweihundert Jahren das Bistum Paderborn verändert: Der Heilige Stuhl in Rom und das Königreich Preußen vereinbarten eine Neuordnung der Bistümer und veränderten damit beispielsweise den Zuschnitt des Bistums Paderborn grundlegend. Die Paderborner Theologin Yvonne Püttmann (29) hat dazu ihre Magisterarbeit „Die Umsetzung der Zirkumskriptionsbulle ‚De salute animarum‘ im Bistum Paderborn von 1821 bis 1844“ bei Professor Dr. Hermann-Josef Schmalor von der Theologischen Fakultät Paderborn geschrieben. Im Gespräch stellt sie ihre Motivation und ihre Ergebnisse vor und benennt, welche Bedeutung das 200-jährige Jubiläum heute hat.
Frau Püttmann, wie haben Sie das Thema Ihrer theologischen Magisterarbeit für sich entdeckt, wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin schon lange historisch interessiert und habe bislang für historische Aufsätze fotografiert. Da konnte ich schon viel über die Geschichtsforschung lernen und ich wollte gerne mal selber zu einem Thema forschen.
Auf das Thema meiner Abschlussarbeit stieß ich auf Umwegen: Über das 200-jährige Bestehen des Paderborner Domkapitels im Jahr 2023. Ich wollte wissen, wie insgesamt die Neugründung eines Bistums funktioniert, zu dem eben auch die Neuinstallierung des Domkapitels gehört. So stieß ich auf die Bulle „De salute animarum“.
Können Sie etwas zur Genese der Arbeit sagen? War es für Sie ein mühsamer Entstehungsprozess?
Ich habe zunächst bisherige Erkenntnisse gesichtet, die in der Literatur zu finden sind. Dann habe ich mir die Quellen, die dort genannt wurden, im Archiv des Erzbistums Paderborn angeschaut. Ab da begann die „Detektivarbeit“. Ich habe Bestände mit Schreiben, Korrespondenzen und Urkunden danach durchsucht, ob es Hinweise auf die Bulle und deren Umsetzung gibt. Grundlegende Fragen am Anfang waren: Wie war die Struktur der Umsetzung? Welche Schritte gab es? Hatte die Neuordnung Auswirkungen auf die Pastoral? Ich war erstaunt, was ich alles herausfinden konnte.
Herausfordernd war für mich das Lesen der Akten, die von Hand geschrieben waren. Dafür habe ich mir die Kurrentschrift angeeignet. Zum Teil waren die Handschriften schwer zu entziffern. Das war ein kritischer Punkt, weil ein Lesefehler zu einer falschen Interpretation der Quelle führen könnte und das darf natürlich nicht passieren.
Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Nach Veröffentlichung der Bulle 1821 gab es im Bistum Paderborn eine fünf Jahre dauernde „Übergangszeit“ bis zum Tod von Fürstbischof Franz Egon von Fürstenberg (1825) und der Inthronisation von Bischof Friedrich Clemens von Ledebur-Wicheln im Jahr 1826. In dieser Zeit verwaltete Richard Dammers als Generalvikar die Gebiete des ehemaligen Fürstbistums Paderborn und als Apostolischer Vikar die „neuen“ Gebiete. Dammers erfragte in den neuen Pfarreien unter anderem die Gläubigenzahl, die Entfernungen zur Pfarrkirche, die Zahl der Gotteshäuser, die Zugehörigkeit zu Kommunen und die soziale Situation vor Ort.
Eine große Herausforderung war, dass das „neue“ Bistum Paderborn eine Einheit wurde, denn es kamen ganz verschiedene Regionen hinzu, beispielsweise Sauerland, Siegerland, Wattenscheid, das ehemalige Bistum Corvey, die Mindener Pfarreien, Rietberg, Wiedenbrück und die östlichen Kommissariate, die Missionsgebiet waren. Die neuen Gebiete waren unterschiedlich strukturiert, die Rechtslage war verschieden und die Pfarreien pflegten Traditionen, die in Verbindung zur „alten“ Ortskirche standen (bestimmte Heiligenfeste, Liedgut). Da war bei der Paderborner Bistumsleitung ein sensibles Händchen gefragt, damit vor allem in der Frömmigkeitspraxis lieb Gewonnenes erhalten werden und zugleich Neues entstehen konnte.
Gab es für Sie Überraschungen bei der Beschäftigung mit dem Thema?
Ja, eine Überraschung, mit der nicht zu rechnen war. Dabei geht es um den Generalvikar und späteren Paderborner Bischof Richard Dammers. In der Literatur wurde Dammers eine Promotion in Theologie oder in Philosophie an der Theologischen Fakultät Paderborn zugeschrieben. Diese ließ sich aber in den Unterlagen nicht nachweisen. Auf seiner Erinnerungsplatte vor den Altarstufen des Paderborner Domes ist allerdings der Doktortitel verzeichnet. Zufällig stieß ich auf den Hinweis, dass Dammers die Ehrendoktorwürde von der Theologischen Fakultät der Königlichen Akademie zu Münster verliehen worden sei. Tatsächlich habe ich im Archiv der Universität Münster die Urkunde über die Verleihung der Ehrenpromotion gefunden. Ich hätte nie damit gerechnet, eine Klarstellung in der Paderborner Bistumsgeschichte vornehmen zu können.
Welche Bedeutung hat die Päpstliche Bulle „De salute animarum“ heute – das Erzbistum Paderborn hat sich ja weiter entwickelt und hat auch sein Gesicht verändert?
Die Bulle „De salute animarum“ hat heute noch Rechtsgültigkeit und wir verdanken ihr die kirchliche Struktur, die wir hier und heute haben, auch wenn es in den vergangenen 200 Jahren natürlich rechtliche Aktualisierungen und Anpassungen gab. Weiterhin Gültigkeit haben beispielsweise das Domkapitel und das Bischofswahlrecht der Domkapitulare. Außerdem konnte das Bistum Paderborn seine theologische Fakultät behalten. Nicht zuletzt sind die finanziellen Zuwendungen zu nennen, die der Staat bis heute leistet, da den Bistümern nie die vertraglich zugesagten Grundstücke für ihre finanzielle Unabhängigkeit übereignet wurden. Und schließlich wurden durch „De salute animarum“ hohe Kirchenämter, wie Domherrenstellen oder das Bischofsamt, auch für bürgerliche Kleriker zugänglich und waren nicht mehr Adligen vorbehalten.
Frau Püttmann, die Päpstliche Bulle ist benannt nach ihren ersten Worten „De salute animarum“ … „Zum Heil der Seelen“ … was bedeutet Ihnen dieser Titel?
Papst Pius VII. hat die ersten Worte für seine Bulle wohl mit Bedacht gewählt. Trotz der vielen rechtlichen und organisatorischen Aspekte ging es bei der Neuorganisation der katholischen Kirche um die Menschen und ihre Gottesbeziehung. „Zum Heil der Seelen“ sollte immer Handlungsrichtschnur jedes Gläubigen und des kirchlichen Wirkens insgesamt sein, ganz besonders in Umbruchzeiten. Es geht nicht zuerst um Strukturen, sondern darum, dass der Mensch das Leben in Fülle erlangen kann. Und dann sollte die Maxime lauten: Was braucht es, um das zu verwirklichen.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Text und Fotos: Thomas Throenle, Erzbistum Paderborn